| |
| |
| |
| |
| |
Die Idee, Daten so aufzubewahren, dass eine Maschine sie lesen und verstehen konnte, stammt aus einer Zeit, in der an Computer und Rechenanlagen noch nicht im entferntesten zu denken war. Schon zu Beginn des 18. Jahrhunderts baute Joseph-Marie Jaquard einen Webstuhl, der mit Hilfe eines Lochstreifens in der Lage wahr, automatisch die einzelnen Fäden während des Webvorganges zu bedienen.
Das Prinzip war so einfach wie wirkungsvoll: Metallstifte tasteten den Lochstreifen ab. Trafen sie auf ein Loch, betätigten sie einen Hebel, der wiederum einen Faden hob. War an der entsprechenden Stelle des Lochstreifen kein Loch, so blieb der Faden liegen.
Die Abbildung zeigt einen solchen Webstuhl. Auf der linken Seite ist das Lochband recht deutlich zu erkennen, welches sich vom oberen Teil, wo sich die Stifte befinden, nach unten schlängelt.
Mit der Idee der Lochstreifen legte Jaquard den Grundstein für die automatisierte Fertigung und die digitale Datenspeicherung, welche allerdings erst gute hundert Jahre später ihren großen Auftritt haben sollte.
Im Verlauf des 19. Jahrhunderts boomten die Sozialwissenschaften. Die erfolgreiche Anwendung und Weiterentwicklung der Wahrscheinlichkeitsrechnung vor allem im Versicherungswesen führte zu einer großen Anzahl statistischer Erhebungen, die rasch immer umfangreicher wurden. Der Erhebungs- und Auswertungsaufwand stieg ins unermessliche und war gegen Ende des 19. Jahrhunderts manuell kaum noch zu bewältigen. So standen zum Beispiel die Ergebnisse der 10. Volkszählung in den USA von 1880 erst sieben Jahre nach deren Erhebung zur Verfügung.
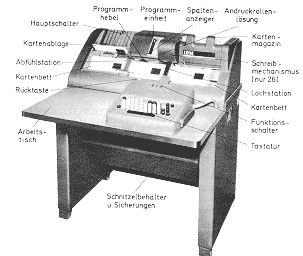 Aus dieser Not heraus konstruierte Hermann
Hollerith, ein Mitarbeiter des amerikanischen Zensusbüros, welches die
Volkszählungen durchführte, eine Maschine, mit deren Hilfe es möglich sein sollte,
einmal erhobene Daten schneller und präziser als mit dem manuellen Verfahren auszuwerten.
Seine Idee war, die Daten jedes US-Bürgers auf einer Karte in Form von Löchern zu
speichern, welche dann mit einer von ihm entwickelten Zählmaschine ausgewertet wurden.
Das Verfahren, Daten in Lochform auf einem Streifen zu speichern, kannte er aus der
Industrie, wo der Lochstreifen seit Jacquards Webstuhl Verbreitung gefunden hatte. Der National
Geographic berichtet in seiner Januarausgabe von 1900 über
dieses neue, ungewöhnliche Verfahren. Der Erfolg der Hollerith-Maschine und des ebenfalls
nach seinem Erfinder benannten Hollerith-Verfahrens war durchschlagend: Die Auswertung der
Volkszählung von 1890, in der es zum ersten Mal im großen Stil zur Anwendung kam, war
bereits zwei Jahre später beendet, und das, obwohl eine zwölfmal höhere Datenmenge
verarbeitet werden musste als bei der Volkszählung davor.
Aus dieser Not heraus konstruierte Hermann
Hollerith, ein Mitarbeiter des amerikanischen Zensusbüros, welches die
Volkszählungen durchführte, eine Maschine, mit deren Hilfe es möglich sein sollte,
einmal erhobene Daten schneller und präziser als mit dem manuellen Verfahren auszuwerten.
Seine Idee war, die Daten jedes US-Bürgers auf einer Karte in Form von Löchern zu
speichern, welche dann mit einer von ihm entwickelten Zählmaschine ausgewertet wurden.
Das Verfahren, Daten in Lochform auf einem Streifen zu speichern, kannte er aus der
Industrie, wo der Lochstreifen seit Jacquards Webstuhl Verbreitung gefunden hatte. Der National
Geographic berichtet in seiner Januarausgabe von 1900 über
dieses neue, ungewöhnliche Verfahren. Der Erfolg der Hollerith-Maschine und des ebenfalls
nach seinem Erfinder benannten Hollerith-Verfahrens war durchschlagend: Die Auswertung der
Volkszählung von 1890, in der es zum ersten Mal im großen Stil zur Anwendung kam, war
bereits zwei Jahre später beendet, und das, obwohl eine zwölfmal höhere Datenmenge
verarbeitet werden musste als bei der Volkszählung davor.
Ermutigt von diesem Erfolg fanden die Hollerith Maschinen rasch große Verbreitung in sowohl öffentlichen als auch privaten Einrichtungen. Die amerikanische Regierung setzte hunderte dieser Maschinen während des Ersten Weltkriegs ein: Die US-Army verwaltete mit ihnen ihr Inventar sowie medizinische und psychologische Daten und das War Industries Board, welches die Wirtschaft zu Zeiten des Krieges in hohem Maße kontrollierte, regelte seinen Geldverkehr mit Hilfe dieser Maschinen.
Mehr als die Regierung nutzte jedoch die Wirtschaft die Lochkarten, um mit der Konkurrenz mithalten zu können. In der Zeit nach 1890 fand in der amerikanischen Wirtschaft ein enormes Wachstum statt und die Unternehmen stellten sämtliche Inventarverzeichnisse und jegliche Kontenüberwachung auf die neue Technik um, da sie sonst auf dem Markt nicht mehr schnell genug reagieren konnten. So fingen Eisenbahngesellschaften etwa 1906 damit an, ihre Systeme auf die neue Technik umzustellen, um das komplizierte Papierverfahren zur Planung des Verkehrs zu ersetzen und lochkartengestützte Maschinen zur Fahrplanerstellung einzusetzen. Versicherungen folgten auf dem Fuße: die Aetna Life and Caualty company verwendete ab 1910 Hollerith-Maschinen, um Sterblichkeitsdaten auszuwerten. In den Führungsetagen besaß diese Technik hohes Ansehen: in einer Sprache die wir von heutigen Reports über die Computerisierung gewohnt sind, schrieb 1926 ein Autor:
"Lochkartensysteme sind bewährte Mittel, um auf ökonomische Weise Fakten und Zusammenhänge zu ermitteln, die grundlegend für das intelligente Betreiben einer Eisenbahn sind, von denen Geschäftsdaten schnell und akkurat ausgewertet und den Entscheidungsträgern präsentiert werden können, zum Zeitpunkt, an dem sie gebraucht werden, in einer Form, die sich zum Handeln am besten eignet." -- aus "Railway Accounting with Punch Cards", Railway Review 79 (September 4, 1926)
Lochkartenmaschinen waren modern und effizient, das, was wir heute "High Tech" nennen würden. Sie wurden bald zum Ausdruck dessen, was "up to date" und geschäftsmäßg war.
In den 1940ern breitete sich die Lochkartentechnik immer weiter aus. In der Bevölkerung haben sie schnell den Ruf, Zeichen einer neuen Art von Bürokratie zu sein. Trotzdem war die Technologie noch exotisch. Die New Yorker brachte 1940 einen Artikel, in dem von Menschenmengen berichtet wird, die sich vor dem Fenster eines Büroaustatters sammelten um eine Lochkarten-Sortiermaschine bei der Arbeit zu sehen.
Doch auch das verging bald und Lochkarten wurden ein Teil des täglichen Lebens. Bibliotheken begannen, ihre Buchbestände anhand von Lochkarten zu verwalten. Polizeiämter benutzten sie, um Kriminelle aufzuspühren. Ihr Einsatz in der Lohn- und Betriebsmagement verstärkte sich. Zeitungen und Zeitschriften schrieben populäre Artikel über diese Technologie. Die Reporter überschlugen sich dabei fast mit Metaphern für diese neue Art Maschinen. So nannte die Saturday Evening Post die Hollerith-Maschine des Los Angeles Police Department einen "mechnischen Sherlock Holmes", einen " Roboter, der Verbrechen hasst" oder den "Detektiv, der niemals schläft."
In Deutschland allerdings sollte sich sehr bald die Kehrseite der neuen Informationstechnik offenbaren. In den Volkszählungen von 1930 und 1940, in denen ebenfalls Hollerith-Maschinen mit Lochkartentechnik eingesetzt worden waren, wurden unter anderem nach Religion und nationaler Herkunft gefragt. Das gab den Nationalsozialisten natürlich ein perfektes Werkzeug in die Hände, schnell und gründlich Juden und Zigeuner aus der Masse der Bevölkerung herauszufiltern. Nach Aussagen während der Nürnberger Prozesse war eines der ersten Dinge, welche die ankommenden Gefangenen im Lager Treblinka zu sehen bekamen, ein Angestellter an einer Hollerithmaschine, der ihre Daten auf eine Lochkarte stanzte.
Spätestens in den 1950ern, nach der Erfindung des Computers und seines Siegezuges durch die Geschäftswelt, wurden Lochkarten zur Selbstverständlichkeit. Firmen verschickten Lochkarten zusammen mit Rechnungen: Telefonunternehmen, Zulieferer und selbst kleinere Geschäfte erkannten, dass sich das gesamte Kassenwesen mit Hilfe der Lochkarten vereibfachen ließ, indem man die Karten selbst anstelle eines Schecks als Zahlungsmittel verwendete.
Die studentischen Revolten der 1960er Jahre machten auch vor der Lochkarte nicht halt. Besonders in den USA wurde sie zum Symbol der Dominanz der Maschinen über den Menschen. Man fühlte sich von den neuen Maschinen, die die Verwaltung der Gesellschaft übernommen zu haben schienen, in die Enge getrieben, den Menschen nur noch auf das Stück Pappe mit den Löchern degradiert, der möglichst maschinenlesbar sein musste. Do not fold, spindle or mutilate! war ein gebräuchlicher zynsicher Satz, mit denen sich vor allem Studenten charakteriserten und der sich von dem warnenden Aufdruck auf allen Lochkarten ableitete. Doch der Protest richtete sich auch in eine andere Richtung, gegen ein Phänomen, das zu dieser Zeit erstmals auftrat: den immer gröfleren Einfluss, den einzelne monopolistische Unternehmen - in erster Linie IBM, größter Hersteller von Lochkarten - auf die Gesellschaft ausüben konnten.
![]()
Mit den 1970er Jahren wurde es ruhiger um das Medium. Die Computer und mit ihnen die Lochkarten waren ein fester Bestandteil der Gesellschaft geworden. So fest, dass Lochstreifen gern als Girlanden auf Festen und Lochkarten gar als Weihnachtsbaumschmuck verwendet wurden! Doch die Entwicklung der Computertechnik hatte gerade erst begonnen und es stand fest, dass die Möglichkeiten mit der mechanischen Datenaufzeichnung begrenzt und zu starr waren. Die Lochkarte war ausgereizt und neue Speicherverfahren standen in den Startlöchern, so die magnetische Speicherung auf Bändern oder großen Magnettrommeln, welche um ein Vielfaches schneller, größere Aufnahmekapazitäten auf kleinerem Raum besaßen und störungsunanfälliger waren.
Seit Mitte der siebziger Jahre ist Lochkarte auf dem Rückzug und heute so gut wie nicht mehr existent. In nur wenigen Bereichen hat sie sich noch gehalten, so zum Beispiel in einigen Stempeluhren oder kurioserweise bei den amerikanischen Wahlautomaten, und selbst dort werden sie in naher Zukunft von elektronischen Zählgeräten ersetzt werden.
![]()
Die Größe und Form einer Lochkarte haben sich seit ihrer Erfindung durch Hermann Hollerith nicht geändert: 18,5 cm lang, 8,1 cm hoch und 0,02 cm dick.
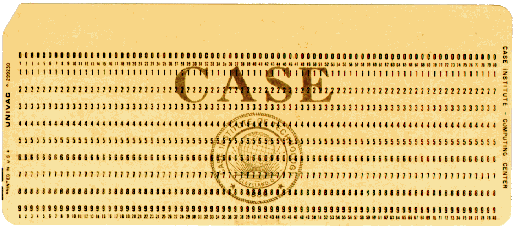
Der ursprüngliche Code, der für Daten auf Lochkarten genutzt wurde, besaß lediglich 240 mögliche Punkte, an denen Löcher gesetzt weren konnten. Doch schon im frühen 20. Jahrhundert wurde ein neues Format eingeführt, welches 45 Zeilen mit je 12 Lochpunkten pro Zeile zuließ (540 Punkte pro Karte). Die Löcher auf diesen Karten waren rund. 1928 stellte IBM ein 80-Spalten-Format mit rechteckigen Löchern vor, womit die Datenmenge, die auf einer Karte gespeichert werden konnte, beinahe verdoppelt wurde. Mitte der dreißiger Jahre mutmaßte IBM, dass die runden Löcher aufgrund ihres größeren Platzanspruches bald verschwunden sein würden.
Tatsächlich überlebten die runden Löcher bis in die frühen 1990er, wenn auch nur in äuflerst wenigen Anwendungen. Es gibt zwei Gründe dafür: Erstens besaß IBM das Patent auf das neue rechteckige Format, so dass die Konkurenz auf das alte Format angewiesen war. Zweitens jedoch erfand Ramington Rand, einer der Hauptkonkurrenten IBMs aus der Vor-Computer-Zeit, einen 6-Bit Code, der es möglich machte, 90 Zeilen Text auf den alten 45-Zeilen-Karten zu speichern. Als Remington Rand UNIVAC kaufte, integrierten sie natürlich ihre 90-Zeilen-Karte in die UNIVAC-Computer.
Erst in den späten 1960er Jahren wich man vom ursprünglichen Kartenformat ab. IBM stellte eine 96-Zeilige Karte vor, die erheblich kleiner als Holleriths Original war, jedoch mehr Speicherkapazität als alle anderen Karten auf dem Markt besaß. Trotz dieser technischen Neuerung konnte sich das Modell nicht mehr durchsetzen, denn viele Anwender gingen bei Systemneuanschaffungen bereits zu neuen Speichermethoden über. Den Lochkarten stand von nun an eine neue Aufgabe als Schmierpapier bevor.
![]()